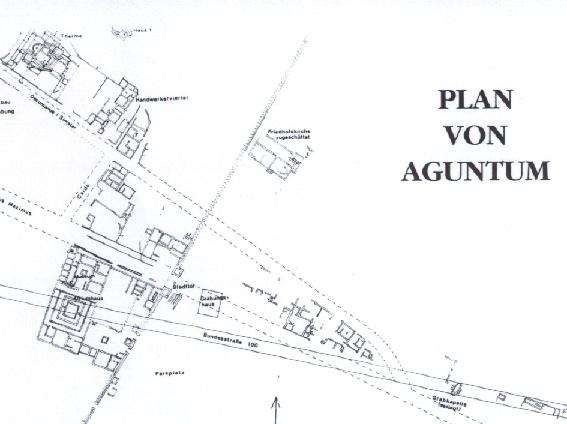| Aguntum |
 Die
erste schriftliche Nachricht über Aguntum liefert uns Plinius, der Aguntum
gemeinsam mit Iuvavum (Salzburg), Teurnia (St.Peter in Holz) und Celeia
(Celje) als ein unter Kaiser Claudius errichtetes municipium nennt. Die
archäologischen Forschungen haben ergeben, daß Aguntum nicht erst etwa
unter Claudius neu gegründet worden ist, sondern das Gebiet bereits vorher
besiedelt war. Claudius erhob die Siedlung in den Rang eines municipiums.
Eine solche Stadt wurde von einem 100 köpfigen Gemeinderat, von 2 Bürgermeistern
(Duumvirn), von 2 Hauptverantwortlichen für Wirtschaft und Sicherheit
(aediles) und vom "Finanzstadtrat" (quaestor) verwaltet. Im 1. und 2.
Jh. n. Chr. erlebte Aguntum eine friedliche und wirtschaftlich gute Zeit,
während im 3. Jh. n. Chr. erste Unruhen durch die immer wieder in das
römische Reich einfallenden Germanenstämme verursacht wurden, die deutliche
Zerstörungshorizonte auch in Aguntum hinterließen. Ab diesem Zeitpunkt
können wir ein prägnantes Aufblühen der Ansiedlungen an fortifikatorisch
günstig gelegenen Höhenzügen, wie etwa am Kirchbichl in Lavant feststellen.
Nach gravierenden Zerstörungen in der Zeit um 400 n. Chr. erholte sich
Aguntum noch einmal, um schließlich um 600 n. Chr. in der großen Schlacht
zwischen Bajuwaren und Slawen, unterzugehen. Die wissenschaftlichen Grabungen
in Aguntum werden seit Beginn des 20. Jhs. mit unterschiedlicher Intensität,
unterbrochen durch zwei Weltkriege, durchgeführt. Das Atriumhaus ist heute
zum Großteil von einem hölzernen Schutzbau überdacht. Dieser Bau ist innerhalb
der Alpen einmalig. Es handelt sich um eine Hausform, die wir z.B. aus
den Vesuvstädten kennen, und die für das heiße südliche Klima entwickelt
wurde, die aber für das feucht und kühle Wetter in dieser Gegend ungeeignet
scheint. Das Haus diente zur Repräsentation eines reichen Besitzers. Im
eigentlichen Atrium stieß man auf sorgfältig gearbeitetes Marmorbecken.
Ein Kanal verband dieses Sammelbecken mit dem großen im Garten des Atriumhauses
liegenden zweiten Wasserbecken mit Marmorboden (16 x 14,5 m groß), das
1994 entdeckt wurde.Der Garten war von einem Umgang umgeben, dessen Ziegeldach
von gemauerten Pfeilern getragen wurde. Die Stadtmauer ist in typisch
römischer Marnier mit zwei Mauerschalen, zwischen die Steine und Erdmaterial
eingebracht wurden, errichtet und hat eine Gesamtstärke von 2,45 m. Angenommen
wird eine ursprüngliche Höhe von 6 m. Möglicherweise trug die Mauer auch
Zinnen. Das Haupttor ist links und rechts von einem Turm flankiert. Beide
Türme besitzen interessanterweise an der Außenseite Fenster und Türen.
Dies könnte bedeuten, daß die Aguntiner Mauer keinem ernsthaften fortifikatorischen
Zweck dienen sollte, sondern daß es sich hier eher um einen Repräsentationsbau
handeln könnte. Das sogennannte Handwerkerviertel besteht aus einfachen
Häusern, die sich meist aus zwei Räumen zusammensetzen, einem Küchen-Wohnraum
und einer Werkstatt mit Feuerstelle. Die Wohnräume sind häufig mit einer
Fußbodenheizung versehen. Die Häuser besaßen Ziegeldächer, Estrich- und
Ziegelböden und als Hinweis auf einen gewissen Wohlstand ihrer Besitzer
manchmal Fenster aus Glas. Die Bewohner dieser Häuser widmeten sich vor
allem der Metallverarbeitung. Das Handwerkerviertel gehört zum Großteil
in die Spätantike, ist also jünger als das Atriumhaus, das seine Blüte
im 1. und 2. Jhd. n. Chr. erlebte. Die große Therme ist eine der seltenen
Thermenbauten aus der Römerzeit in Österreich. Die heute für den Besucher
noch ziemlich verwirrend übereinander liegenden einzelnen Bauphasen dieses
Bäderbaues werden bei seit dem Jahre 1998 erfolgten Restaurierung deutlich
voneinander unterschieden. Die Blütezeit der Aguntiner Therme liegt im
1. bis zum 3. Jh. n. Chr. Neben dem Parkplatz kommt man bei der frühchristlichen
Grabkapelle vorbei. Sie steht nicht an ihrem ursprünglichen Platz und
wurde im Zuge des modernen Straßen- und Brückenbaues neu aufgemauert.
Es ist ein Doppelapsidenbau, der entfernt an eine Kreuzform erinnert.
Der einfache Steinsarkophag barg ursprünglich zwei Skelette. Gegenüber
auf der anderen Seite der Drautalstraße steht ein großer Grabaltar aus
Marmor, der vom Aufwand und Reichtum mancher Aguntiner Familien zeugt.
Dahinter liegen in der Bodensenke noch weitere Ruinen einfacher Wohnhäuser,
die sogen. Vorstadt. Diese Häuser entsprechen in vielem den Bauten im
sogen. Handwerkerviertel. Außer den im Grabungsmuseum verwahrten Funden,
befinden sich viele Stücke aus Aguntum in Schloß Bruck bei Lienz.
Die
erste schriftliche Nachricht über Aguntum liefert uns Plinius, der Aguntum
gemeinsam mit Iuvavum (Salzburg), Teurnia (St.Peter in Holz) und Celeia
(Celje) als ein unter Kaiser Claudius errichtetes municipium nennt. Die
archäologischen Forschungen haben ergeben, daß Aguntum nicht erst etwa
unter Claudius neu gegründet worden ist, sondern das Gebiet bereits vorher
besiedelt war. Claudius erhob die Siedlung in den Rang eines municipiums.
Eine solche Stadt wurde von einem 100 köpfigen Gemeinderat, von 2 Bürgermeistern
(Duumvirn), von 2 Hauptverantwortlichen für Wirtschaft und Sicherheit
(aediles) und vom "Finanzstadtrat" (quaestor) verwaltet. Im 1. und 2.
Jh. n. Chr. erlebte Aguntum eine friedliche und wirtschaftlich gute Zeit,
während im 3. Jh. n. Chr. erste Unruhen durch die immer wieder in das
römische Reich einfallenden Germanenstämme verursacht wurden, die deutliche
Zerstörungshorizonte auch in Aguntum hinterließen. Ab diesem Zeitpunkt
können wir ein prägnantes Aufblühen der Ansiedlungen an fortifikatorisch
günstig gelegenen Höhenzügen, wie etwa am Kirchbichl in Lavant feststellen.
Nach gravierenden Zerstörungen in der Zeit um 400 n. Chr. erholte sich
Aguntum noch einmal, um schließlich um 600 n. Chr. in der großen Schlacht
zwischen Bajuwaren und Slawen, unterzugehen. Die wissenschaftlichen Grabungen
in Aguntum werden seit Beginn des 20. Jhs. mit unterschiedlicher Intensität,
unterbrochen durch zwei Weltkriege, durchgeführt. Das Atriumhaus ist heute
zum Großteil von einem hölzernen Schutzbau überdacht. Dieser Bau ist innerhalb
der Alpen einmalig. Es handelt sich um eine Hausform, die wir z.B. aus
den Vesuvstädten kennen, und die für das heiße südliche Klima entwickelt
wurde, die aber für das feucht und kühle Wetter in dieser Gegend ungeeignet
scheint. Das Haus diente zur Repräsentation eines reichen Besitzers. Im
eigentlichen Atrium stieß man auf sorgfältig gearbeitetes Marmorbecken.
Ein Kanal verband dieses Sammelbecken mit dem großen im Garten des Atriumhauses
liegenden zweiten Wasserbecken mit Marmorboden (16 x 14,5 m groß), das
1994 entdeckt wurde.Der Garten war von einem Umgang umgeben, dessen Ziegeldach
von gemauerten Pfeilern getragen wurde. Die Stadtmauer ist in typisch
römischer Marnier mit zwei Mauerschalen, zwischen die Steine und Erdmaterial
eingebracht wurden, errichtet und hat eine Gesamtstärke von 2,45 m. Angenommen
wird eine ursprüngliche Höhe von 6 m. Möglicherweise trug die Mauer auch
Zinnen. Das Haupttor ist links und rechts von einem Turm flankiert. Beide
Türme besitzen interessanterweise an der Außenseite Fenster und Türen.
Dies könnte bedeuten, daß die Aguntiner Mauer keinem ernsthaften fortifikatorischen
Zweck dienen sollte, sondern daß es sich hier eher um einen Repräsentationsbau
handeln könnte. Das sogennannte Handwerkerviertel besteht aus einfachen
Häusern, die sich meist aus zwei Räumen zusammensetzen, einem Küchen-Wohnraum
und einer Werkstatt mit Feuerstelle. Die Wohnräume sind häufig mit einer
Fußbodenheizung versehen. Die Häuser besaßen Ziegeldächer, Estrich- und
Ziegelböden und als Hinweis auf einen gewissen Wohlstand ihrer Besitzer
manchmal Fenster aus Glas. Die Bewohner dieser Häuser widmeten sich vor
allem der Metallverarbeitung. Das Handwerkerviertel gehört zum Großteil
in die Spätantike, ist also jünger als das Atriumhaus, das seine Blüte
im 1. und 2. Jhd. n. Chr. erlebte. Die große Therme ist eine der seltenen
Thermenbauten aus der Römerzeit in Österreich. Die heute für den Besucher
noch ziemlich verwirrend übereinander liegenden einzelnen Bauphasen dieses
Bäderbaues werden bei seit dem Jahre 1998 erfolgten Restaurierung deutlich
voneinander unterschieden. Die Blütezeit der Aguntiner Therme liegt im
1. bis zum 3. Jh. n. Chr. Neben dem Parkplatz kommt man bei der frühchristlichen
Grabkapelle vorbei. Sie steht nicht an ihrem ursprünglichen Platz und
wurde im Zuge des modernen Straßen- und Brückenbaues neu aufgemauert.
Es ist ein Doppelapsidenbau, der entfernt an eine Kreuzform erinnert.
Der einfache Steinsarkophag barg ursprünglich zwei Skelette. Gegenüber
auf der anderen Seite der Drautalstraße steht ein großer Grabaltar aus
Marmor, der vom Aufwand und Reichtum mancher Aguntiner Familien zeugt.
Dahinter liegen in der Bodensenke noch weitere Ruinen einfacher Wohnhäuser,
die sogen. Vorstadt. Diese Häuser entsprechen in vielem den Bauten im
sogen. Handwerkerviertel. Außer den im Grabungsmuseum verwahrten Funden,
befinden sich viele Stücke aus Aguntum in Schloß Bruck bei Lienz.